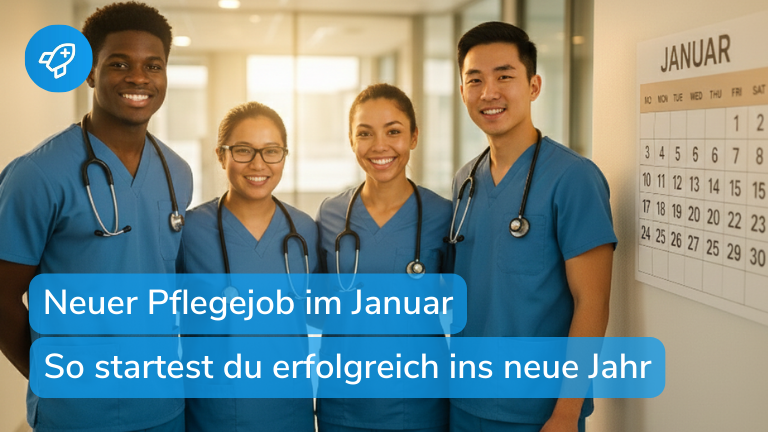Was umfasst das Personalbemessungsverfahren in der Pflege?
Das neue Personalbemessungsverfahren (§ 113 c SGB XI) legt fest, wie viel Personal mit welchen Qualifikationen stationäre Pflegeeinrichtungen einstellen müssen. Basis hierfür ist eine vom Bremer Professor Dr. Heinz Rothgang und seinem Team durchgeführte Studie.
Seit dem 1. Januar 2026 sind stationäre Pflegeeinrichtungen gesetzlich verpflichtet, ihren Personalbedarf nach diesem Verfahren zu berechnen und entsprechend umzusetzen. Die Übergangsphase ist beendet. Jetzt zählt die tatsächliche Einhaltung.
Orientierung am Pflegebedarf (Case-Mix-Prinzip)
Neu ist, dass sich die Vorgabe zur Ermittlung des Bedarfs – anders als bei der 1993 festgelegten Fachkraftquote – an der Anzahl der Pflegebedürftigen als auch an deren Pflegegrad orientiert. Oder anders ausgedrückt: Je höher der Pflegegrad der Bewohner:innen, desto höher die Anforderungen an die Qualifikation des Personals. Einrichtungen mit höherem Pflegegradmix benötigen folglich mehr Pflegefachkräfte.
Der Personalbedarf, welcher für jede Einrichtung individuell gilt, wird auf Basis des sogenannten Case-Mix errechnet.
Acht Qualifikationsniveaus im Überblick
Das Verfahren unterscheidet acht Qualifikationsniveaus (QN 1–8), vom ungelernten Servicepersonal bis zur pflegewissenschaftlichen Leitungsebene, nach denen sich der Personalbedarf berechnet:
- Pflegewissenschaftlicher (QN 8)
- Pflegedienstleitung (QN 7)
- Wohnbereichsleitung (QN 6)
- Pflegefachkraft mit Zusatzqualifikation, z. B. Palliativpflege (QN 5)
-
Pflegefachkräfte mit dreijähriger Ausbildung (QN 4)
-
Assistenzkräfte mit 1–2-jähriger Ausbildung (QN 3)
-
Pflegehilfskräfte mit 2–6-monatigem Basiskurs (QN 2)
-
Servicekräfte ohne Ausbildung (QN 1)
Neue Rollenverteilung im Pflegealltag
Die neuen Regelungen zur Personalbemessung nach § 113 c SGB XI sehen vor, dass Pflegeleistungen künftig gestaffelt nach diesen Qualifikationsstufen erbracht werden.
Das heißt in der Praxis, dass die examinierten Pflegekräfte (Pflegefachkräfte) nur noch Aufgaben übernehmen, für die eine Fachkraft erforderlich ist (Vorbehaltsaufgaben).
Verschiebung im Qualifikationsmix
Dies führt zu einer effektiven Absenkung der Fachkraftquote und einer Anhebung der Hilfskraftquote. Häufig ist vom sogenannten Qualifikationsmix 40/30/30 die Rede:
Das bedeutet, dass sich die Personalzusammensetzung rechnerisch in
- ca. 40 % Pflegefachkräfte (QN 4)
- ca. 30 % Assistenzkräfte (QN 3)
- ca. 30 % Hilfskräfte (QN 1 und QN 2)
Das entlastet Fachkräfte gezielt – erfordert aber auch ein Umdenken in der Aufgabenverteilung.
Investitionen in Personal- und Organisationsentwicklung
Die Rothgang-Studie betont außerdem: Es reicht nicht aus, zusätzliche Pflegekräfte einzustellen. Auch die Personal- und Organisationsentwicklung muss gestärkt werden, damit Pflegefach- und Assistenzkräfte ihre neuen Rollen einnehmen und ausfüllen können.
Dieses Video erklärt in 3 Minuten das Wichtigste zur Personalbemessung in der Pflege:
Umsetzungspflicht seit Januar 2026: Was Einrichtungen jetzt beachten müssen
Das Personalbemessungsverfahren PeBeM ist seit dem 1. Juli 2023 in Kraft. Die Pflicht zur verbindlichen Umsetzung gilt seit dem 1. Januar 2026.
Das bedeutet: Einrichtungen müssen jetzt nachweisen, dass sie entsprechend des berechneten Bedarfs personell aufgestellt sind. Andernfalls drohen Konsequenzen bei MDK-Prüfungen, Pflegesatzverhandlungen oder im Qualitätsnachweis.
Welche Einrichtungen sind von Personalbemessungsverfahren betroffen?
Die neue Personalbemessung in der Pflege gilt verbindlich für stationäre Einrichtungen der Langzeitpflege. Es betrifft vor allem die Altenpflege. Andere Sektoren – wie Tagespflege oder ambulante Dienste – sind aktuell nicht verpflichtet, das Verfahren anzuwenden.
Nicht betroffen sind bisher:
-
Einrichtungen der teilstationären Pflege (z. B. Tagespflege)
-
Kurzzeitpflege und
-
ambulante Pflegedienste
Teilstationäre Pflegeeinrichtungen
Die Rothgang-Studie hat für den teilstationären Bereich (z. B. Tagespflege) ebenfalls einen personellen Mehrbedarf ermittelt. Allerdings lässt sich das PeBeM-Konzept nicht ohne Weiteres auf diesen Bereich übertragen.
Der Grund: In der teilstationären Pflege sind die Fachkraftanteile geringer, der Pflegebedarf zeitlich begrenzt und das Leistungsgeschehen sehr dynamisch. Außerdem gibt es enge Schnittstellen zur ambulanten Pflege und zum betreuten Wohnen, was eine starre Personalvorgabe erschwert.
Deshalb hat der Gesetzgeber die Einführung einer einheitlichen Personalbemessung für den teilstationären Bereich vorerst ausgesetzt. Ob und wann hier ein eigenes Bemessungsmodell eingeführt wird, ist noch offen.
Ambulante Pflege
Für die ambulante Pflege kommt die Rothgang-Studie zu dem Schluss, dass eine Personalbemessung nach dem stationären Modell nicht direkt übertragbar ist. Denn Art und Umfang der Leistungen richten sich stark danach, was Pflegebedürftige und ihre Angehörigen als wichtig erachten und nicht nach standardisierbaren Versorgungsgraden. Eine objektive Berechnung des Personalbedarfs ist dadurch deutlich schwieriger.
Die Roadmap des Bundesgesundheitsministeriums sieht allerdings vor, neue Modelle für die ambulante Personalbemessung zu entwickeln. Aktuell laufen dazu bundesweite Modellprogramme (z. B. EinSTEP), gefördert durch das GVPG. Ziel ist es, bis spätestens Ende 2026 wissenschaftlich fundierte Ansätze zu erproben, die einen besseren Personalmix und eine spürbare Entlastung ermöglichen.
Es betrifft vor allem die Altenpflege. Andere Sektoren – wie Tagespflege oder ambulante Dienste – sind aktuell nicht verpflichtet, das Verfahren anzuwenden.
Personalbemessung in Krankenhäusern: PPR 2.0 gilt seit Juli 2024
Auch in Krankenhäusern gilt seit dem 1. Juli 2024 eine Personalbemessungsverordnung (PPBV). Grundlage dafür ist die Pflegepersonalregelung (PPR 2.0). Diese ist eine Weiterentwicklung der Pflegepersonalregelung von 1993.
Die PPR 2.0 verpflichtet Krankenhäuser gesetzlich dazu, ihre Patient:innen täglich zu erfassen. Die Einstufung erfolgt in standardisierte Aufwandsgruppen – je nach Schwere der Pflegebedürftigkeit. Ziel ist es, den tatsächlichen Pflegebedarf transparent zu machen und eine verbindliche Berechnung des notwendigen Pflegepersonals zu ermöglichen.
Stufenweise Einführung der PPR 2.0
-
Seit 2024: Alle Kliniken müssen die PPR 2.0 anwenden, dokumentieren und quartalsweise an das InEK (Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus) melden.
-
Ab 2027: Es sollen verbindliche Personalvorgaben folgen. Krankenhäuser, die diese unterschreiten, müssen mit Sanktionen rechnen.
Die PPR 2.0 wird dabei als „lernendes System“ verstanden. Das heißt: Die gesammelten Daten dienen dazu, das Modell kontinuierlich zu verbessern – etwa durch Anpassung der Kategorien oder Berücksichtigung neuer Versorgungsbedarfe.
Wie wird die Personalquote ermittelt?
Nach der neuen Neuregelung muss jede Einrichtung ihren Personalbedarf individuell ermitteln. Die Grundlage für die Ermittlung des Personalmixes ist die Pflegegradstruktur der Bewohner:innen.
Je höher der Pflegegrad-Anteil in einer Einrichtung, desto höher fällt der Personalbedarf aus – besonders an Pflegefachkräften.
Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch die durchschnittlichen Personalanhaltswerte je Pflegegrad und Qualifikationsstufe gemäß aktueller Gesetzeslage (§ 113c SGB XI).
Berechnung der Personalbemessung (Tabelle)

Hinweis: Die derzeit geltenden Personalanhaltswerte basieren auf der wissenschaftlichen Empfehlung von Prof. Rothgang. Ab 2026 prüft der Gesetzgeber, ob diese Werte angehoben oder differenzierter ausgestaltet werden sollen – abhängig von den bis dahin gesammelten Praxiserfahrungen und Modellprojektergebnissen.
Beispiel: Berechnung der Personalbemessung in der Pflege
Der Personalbedarf einer Pflegeeinrichtung wird auf Grundlage der Bewohnerstruktur nach Pflegegraden berechnet. Für jedes Qualifikationsniveau (z. B. Pflegefachkraft, Assistenz, Hilfskraft) gelten festgelegte Personalanhaltswerte, die mit der jeweiligen Anzahl an Bewohner:innen multipliziert werden.
Beispiel: Bedarf an ungelernten Hilfskräften (QN 1)
Die folgende Berechnung zeigt, wie viele Hilfskräfte ohne Ausbildung (QN 1) für eine Beispiel-Einrichtung mit 74 Bewohner:innen benötigt werden:Der Personalbedarf an Hilfspersonal ohne Ausbildung berechnet sich für die unten in der Tabelle stehende Bewohnerzahl wie folgt:
- Pflegegrad 1: 0 ∗ 0,873 = 0
- Pflegegrad 2: 20 ∗ 0,1202 = 2,404
- Pflegegrad 3: 28 ∗ 0,1449 = 4,057
- Pflegegrad 4: 20 ∗ 0,1627 = 3,254
- Pflegegrad 5: 6 ∗ 0,1758 = 1,055
→ Benötigt werden 10,77 Vollzeitstellen von Hilfspersonal ohne Ausbildung für diese Bewohnerstruktur.

Die Berechnungen zur PeBeM zeigen: je höher der Pflegegrad, desto höher der Anteil an Fachkraftpersonal.
Wie kam es zum neuen Personalbemessungsverfahren?
Der Startschuss für das neue Personalbemessungsverfahren fiel mit dem Pflegestärkungsgesetz II, das der Bundestag im Jahr 2016 verabschiedete. Darin wurde festgelegt, dass bis spätestens 30. Juni 2020 ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren entwickelt werden soll, um den Personalbedarf in stationären Pflegeeinrichtungen bedarfsgerecht und einheitlich zu ermitteln.
Der Forschungsauftrag ging nach einer europaweiten Ausschreibung an den Gesundheitsökonom Heinz Rothgang von der Universität Bremen.
Das Ergebnis: die sogenannte Rothgang-Studie, die erstmalig mit echten Versorgungsdaten arbeitet und konkrete Personalanhaltswerte für acht Qualifikationsstufen ableitet. Sie zeigt auch, dass die bis dahin gültige Fachkraftquote von 50 % nicht evidenzbasiert, sondern politisch festgelegt war.
Am 1. Juli 2023 traten die neuen Vorgaben nach § 113c SGB XI in Kraft. Für die Umsetzung galt eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2025. Seit dem 1. Januar 2026 ist die Anwendung des Verfahrens verbindlich.
Wie haben die Wissenschaftler der Universität Bremen das Verfahren entwickelt?
Das Forschungsteam um Prof. Dr. Heinz Rothgang von der Universität Bremen entwickelte das Personalbemessungsverfahren auf Basis einer der bislang umfangreichsten empirischen Studien zur Pflegepraxis in Deutschland.
Dazu begleiteten die Wissenschaftler 1979 Pflegeschichten in insgesamt 62 stationären Einrichtungen – jeweils eine Woche lang vor Ort. Dabei analysierten sie mehr als 130.000 Pflegeinterventionen im realen Arbeitsalltag und bewerteten jede einzelne anhand eines festgelegten Kriterienkatalogs (z. B. Aufwand, Fachlichkeitsgrad, Verantwortung). Ziel war es, den tatsächlichen personellen Aufwand pro Bewohner:in je nach Pflegebedarf objektiv zu erfassen.
Auf Basis dieser Beobachtungsdaten entwickelten sie einen Algorithmus, der je nach Pflegebedarf ermittelt, wie viele Mitarbeitende mit welcher Qualifikation in einer Einrichtung benötigt werden. So entstand das erste wissenschaftlich fundierte Personalbemessungsmodell für die stationäre Langzeitpflege.
→ Zum Abschlussbericht der Rothgang-Studie (PDF): Jetzt Bericht lesen.
Wissenschaftliche Weiterentwicklung im Dezember 2025
Im Dezember 2025 veröffentlichte die Universität Bremen im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums den "Abschlussbericht nach § 8 Abs. 3b SGB XI". Ziel war es, die bisherigen Erfahrungen mit dem PeBeM zu evaluieren und Vorschläge zur Weiterentwicklung zu erarbeiten.
Empfohlen werden unter anderem:
- eine differenziertere Ausgestaltung der Personalanhaltswerte,
- eine stärkere Betonung und Förderung von Assistenzkräften (QN 3),
- sowie mehr Flexibilität für Pflegeeinrichtungen bei der praktischen Umsetzung.
→Zum Abschlussbericht der Rothgang-Studie (PDF – Dezember 2025)
Was sind die wesentlichen Erkenntnisse der Rothgang-Studie zur Personalbemessung?
Die Rothgang-Studie liefert erstmals belastbare Daten zum tatsächlichen Pflegebedarf in stationären Einrichtungen und zeigt gravierende Versorgungsdefizite auf:
-
Pflegeinterventionen konnten häufig nicht vollständig erbracht werden, etwa aus Zeitmangel oder fehlender Unterstützung.
-
Wichtige Teilschritte wurden ausgelassen, z. B. Händedesinfektion, Kontrolle der Wassertemperatur oder das sachgerechte Vorbereiten des Arbeitsplatzes.
-
Besonders häufig traten diese Versorgungsdefizite bei schlechtem Personalschlüssel auf.
Zentrale Ergebnisse:
-
Es gibt einen deutlichen Personalmehrbedarf, insbesondere im Bereich der Assistenzkräfte mit 1–2-jähriger Ausbildung – hier liegt der errechnete Mehrbedarf bei +69 %.
-
Auch bei Pflegefachkräften wurde ein Mehrbedarf festgestellt – jedoch moderater: +3,5 %.
Die Studie macht damit klar: Pflegequalität leidet, wenn Personal fehlt – vor allem in der Grundpflege und bei hygienerelevanten Aufgaben.
Was ist das Ziel der Personalbemessung in der Pflege?
Das Ziel der Personalbemessung ist es, eine bedarfsgerechte und professionelle Pflege sicherzustellen – insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und steigender Pflegebedarfe. Sie basiert auf der qualitativen und quantitativen Versorgungslage in Pflegeeinrichtungen (Quelle: Roadmap des Bundesministeriums für Gesundheit).
Die wichtigsten Ziele im Überblick:
-
Pflegequalität sichern: Pflege soll nicht vom Zufall, sondern vom tatsächlichen Bedarf abhängen.
-
Arbeitsbedingungen verbessern: Ausreichend Personal entlastet Pflegekräfte und erhöht die Arbeitszufriedenheit.
-
Berufsflucht stoppen: PeBeM soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken und Pflege wieder attraktiver machen.
-
Bundeseinheitliche Standards schaffen: Erstmals gibt es eine rechtsverbindliche, einheitliche Bemessungsgrundlage für alle Bundesländer.
Wie soll die Personalbemessung die Qualität der Pflege verbessern?
Das Ziel, die Qualität der Pflege zu verbessern, soll erreicht werden, indem die „knappen Ressourcen“ effizienter eingesetzt werden. Hintergrund ist der, dass immer mehr examinierte Fachkräfte in der Altenpflege fehlen.
Bessere Pflege durch kluge Aufgabenverteilung
-
Examinierte Pflegefachkräfte (QN 4 und höher) sollen sich auf Vorbehaltsaufgaben nach § 4 Pflegeberufegesetz (PflBG) konzentrieren – z. B. Pflegeplanung, Medikationsmanagement, komplexe Versorgungssituationen.
-
Assistenz- und Hilfskräfte (QN 1–3) übernehmen gezielt Aufgaben der Grundpflege und entlasten dadurch das Fachpersonal.
-
Fachkräfte steuern und koordinieren zunehmend den Pflegeprozess, statt jeden Handgriff selbst zu übernehmen.
Ziel: Klare Rollen – weniger Stress
-
Verantwortungsbereiche werden klar definiert, sodass jede:r im Team genau weiß, wofür er oder sie zuständig ist.
-
Es entsteht eine Kooperationskultur, in der sich alle Mitarbeitenden gemäß ihrer Qualifikation einbringen – ohne Über- oder Unterforderung.
-
Die Folge: mehr Zeit für den eigentlichen Pflegeauftrag, weniger Stress, höhere Zufriedenheit und eine spürbare Verbesserung der Versorgungsqualität.
Wie soll der gestiegene Bedarf an Pflegekräften gedeckt werden?
Um den deutlich gestiegenen Personalbedarf zu bewältigen, setzt der Gesetzgeber auf eine mehrstufige Personalausbaustrategie, flankiert durch gezielte Finanzierungsprogramme und gesetzliche Reformen.
Personalausbaustufe ab 1. Januar 2023
Bundesweit wurden 20.000 zusätzliche Assistenzstellen (Qualifikationsniveau QN 3 oder mit Weiterbildungszusage) geschaffen. Die Pflegeversicherung übernimmt die Finanzierung für Einrichtungen, die die Voraussetzungen des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) erfüllen.Personalausbaustufe ab 1. Juli 2023
Mit dem Inkrafttreten des Personalbemessungsverfahrens (PeBeM) begann die schrittweise Neuausrichtung des Personalmix. Gleichzeitig wurden zusätzliche Finanzierungsoptionen geschaffen – insbesondere für Hilfskräfte und Assistenzkräfte, auch um regionale Unterschiede zu berücksichtigen.Evaluation
Laut BMG wurde eine umfassende Evaluation der ersten beiden Stufen im Herbst 2025 abgeschlossen. Der Bericht empfiehlt den weiteren Ausbau der QN-3-Ausbildungskapazitäten sowie flexiblere Finanzierungsregelungen für multiprofessionelle Teams. Eine gesetzliche Umsetzung dieser Empfehlungen steht aktuell (Februar 2026) noch aus.
Überdies läuft bereits ein 2019 verabschiedetes Stellenprogramm mit 13.000 Stellen für Pflegefachpersonen, welches von den gesetzlichen Krankenkassen getragen wird.
GVWG: Beitrag der Krankenkassen
Im Rahmen des GVWG (Gesundheitsversorgungs-weiterentwicklungsgesetz) vom 11.07.2021 wurde zudem beschlossen, dass sich – erstmalig seit Einführung der Pflegeversicherung – die Krankenversicherung an den Kosten der Behandlungspflege in Pflegeheimen beteiligen wird.
In § 37 Absatz 2a heißt es „Die gesetzliche Krankenversicherung beteiligt sich an den Kosten der medizinischen Behandlungspflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen mit einem jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von 640 Millionen Euro, der an den Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung zu leisten ist.“
Neue gesetzliche Initiative: Pflegekompetenzgesetz (in Vorbereitung)
Das geplante Pflegekompetenzgesetz soll den Personalaufbau in der stationären Pflege nachhaltig stärken. Es befindet sich laut Bundesgesundheitsministerium derzeit in finaler Abstimmung auf Fachebene.
Der Kabinettsbeschluss wird für das 2. Halbjahr 2026 erwartet.
Mit dem geplanten Pflegekompetenzgesetz soll der Personalaufbau zusätzlich strukturell flankiert werden. Geplant ist u. a.:
-
Die Erweiterung der Berufsgruppen, die im Rahmen des PeBeM angerechnet werden können , z. B. Betreuungskräfte, Alltagsbegleiter:innen sowie therapeutische Fachkräfte, sofern sie in die pflegerische Versorgung eingebunden sind.
-
Rechtssichere Delegation einfacher Pflegeaufgaben an qualifizierte Hilfs- und Assistenzkräfte, um Pflegefachkräfte stärker auf Vorbehaltsaufgaben zu konzentrieren.
-
Einrichtung einer unabhängigen Fachstelle Pflegepersonalbemessung, die Pflegeeinrichtungen bundesweit berät, etwa bei Organisationsentwicklung, Rollenverteilung und Schulungsbedarf im Rahmen der PeBeM-Umsetzung.
Welche Folgen hat die Personalbemessung für die stationäre Pflege?
Unserer Einschätzung nach bringt PeBeM für die vollstationäre Pflege tiefgreifende Veränderungen mit sich – organisatorisch, personell und kulturell.
Herausforderungen beim Personalaufbau
Auch wenn das neue Verfahren rechnerisch einen geringeren Anteil an Pflegefachkräften vorsieht als die bisherige Fachkraftquote, bleibt die Mitarbeitergewinnung extrem anspruchsvoll. Besonders gefragt sind nun Pflegeassistent:innen mit 1- bis 2-jähriger Ausbildung (QN 3) – eine Qualifikationsgruppe, die lange Zeit kaum gezielt aufgebaut wurde.
-
Der Bedarf an Assistenzkräften steigt stark – laut Rothgang-Studie um rund +69 %.
-
Einrichtungen müssen deshalb nicht nur neue Stellen schaffen, sondern auch verstärkt in Schulung, Umschulung und Anreize zur Qualifizierung investieren.
Umbruch in den Aufgabenverteilungen
Mit dem Case-Mix-Prinzip zieht ein gänzlich neues Verständnis von Teamarbeit ein. Die bisherigen, oft historisch gewachsenen Strukturen werden abgelöst. Künftig gilt:
-
Fachkräfte konzentrieren sich auf komplexe Pflegeprozesse und Steuerung
-
Assistenz- und Hilfskräfte übernehmen eigenverantwortlich definierte Grundpflegeaufgaben
Dieser Rollenwechsel erfordert ein Umdenken auf allen Ebenen – und die Bereitschaft, alte Muster loszulassen.
Chance zur Aufwertung des Pflegeberufs
Trotz aller Herausforderungen bietet das Verfahren auch Potenzial:
-
Die Stärkung der Fachrollen und die zunehmende Akademisierung der Pflege zeigen sich im Qualifikationsmodell
-
Wenn es gelingt, klare Rollen und faire Bedingungen zu schaffen, kann PeBeM zur Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufs beitragen – und langfristig helfen, neue Fach- und Assistenzkräfte zu gewinnen oder zurückzuholen
Wie können sich Arbeitgeber in der Pflege auf die Personalbemessung vorbereiten?
Auch wenn die Übergangsfrist noch bis Ende 2025 läuft, empfehlen wir Ihnen, bereits jetzt aktiv zu werden. So sichern Sie frühzeitig Personal, vermeiden Engpässe und positionieren sich als moderner Arbeitgeber.
1. Personalbedarf analysieren (Soll-/Ist-Abgleich)
Ermitteln Sie Ihren aktuellen Personalbestand nach Qualifikationsniveaus (QN 1–8) und vergleichen Sie ihn mit dem künftigen Bedarf gemäß PeBeM – basierend auf der Pflegegradverteilung Ihrer Einrichtung. So erkennen Sie gezielt Ihre Personallücken und Handlungsfelder.
Pflegehilfskräfte weiterqualifizieren
Der größte Engpass besteht im Bereich der Pflegeassistenzen (QN 3). Prüfen Sie deshalb frühzeitig:
-
Welche erfahrenen Hilfskräfte (QN 1–2) kommen für eine Qualifizierung infrage?
-
Welche Förder- und Prüfmodelle stehen in Ihrem Bundesland zur Verfügung?
Tipp: Nutzen Sie das Pflegestellen-Förderprogramm des BMG zur Refinanzierung von Weiterbildungen und neuen Stellen im Rahmen der Personalausbaustufen.
Recruiting neu denken
Richten Sie Ihre Personalgewinnung auf die neuen Anforderungen aus:
-
Sprechen Sie gezielt auch Assistenz- und Hilfskräfte an – nicht nur examinierte Fachkräfte
-
Positionieren Sie sich als Arbeitgeber, der Entwicklung ermöglicht und neue Rollenmodelle aktiv unterstützt
-
Setzen Sie auf digitale Recruitingkanäle und aktive Ansprache (z. B. Direktnachrichten, Social Media)
Empfehlenswerte Beiträge:
- 9 Trends im Pflege-Recruiting: Worauf kommt es im Jahr 2023 an?
- So gelingt erfolgreiches Employer Branding in der Pflege
- Social-Media-Marketing für die Pflege: ein umfassender Leitfaden für den Einstieg
- Die Top 3 Erfolgsfaktoren für das Recruiting im Gesundheitswesen
- 7 innovative Strategien zur Mitarbeitergewinnung in der Pflege
Pflegefachkräfte auf neue Aufgaben vorbereiten
Neben der Gewinnung von Pflegepersonal gilt es aber auch, die Pflegefachpersonen auf ihre neuen Aufgaben vorzubereiten, sie zu informieren und dahin gehend zu schulen. Manch einge Pflegefachkraft fühlte sich bislang ganz wohl dabei, auch mal die Spülmaschine auszuräumen. Nun sollen diese Aufgaben abgegeben werden.
Mehr Verantwortung zu übernehmen, Aufgaben an Pflegehelfer:innen zu delegieren und in gewisser Weise eine Führungsrolle einzunehmen, ist für viele ungewohnt und unangenehm.
Gehen Sie diesen Wandel aktiv an:
-
Sensibilisieren Sie Ihr Team frühzeitig
-
Bieten Sie Schulungen zu Delegation, Führung und Kommunikation an
-
Etablieren Sie eine wertschätzende Kultur, in der jede Qualifikation ihre Bedeutung hat
Kritische Stimmen: Neue Personalbemessung sorgt für Unsicherheit
Trotz der grundsätzlichen Zustimmung zum neuen Personalbemessungsverfahren äußern verschiedene Fachvertreter:innen deutliche Bedenken bezüglich der Umsetzung und Kommunikation.
Pflegekammer Nordrhein-Westfalen: „Zu schnell, zu starr“
Die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen warnt vor einer zu raschen Umsetzung der Rothgang-Studie in die Praxis. Vor allem in der Langzeitpflege bestehe Unsicherheit – nicht zuletzt, weil viele Pflegefachkräfte in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen.
Leah Dörr, Vorstandsmitglied der Kammer, betont, dass Pflege flexibel sein muss und die Studienbedingungen nicht direkt auf den Alltag übertragbar sind.
Die Kammer fordert daher:
-
eine Überarbeitung der gesetzlichen Vorgaben,
-
die Einbindung von Pflegeexpert:innen in die Entscheidungsprozesse,
-
und eine Neugestaltung der Pflegesätze.
Für die Übergangszeit plädiert die Kammer für die Beibehaltung der Mindest-Fachpersonalquote von 50 Prozent. Langfristig sollten jedoch flexible Lösungen gefunden werden, die die Qualität der Pflege sicherstellen und Einrichtungen nicht durch starre Personalgrenzen einschränken.
Pflegeexperte Michael Wipp: „Bundesweite Einheitlichkeit fehlt“
Der Pflegeberater Michael Wipp kritisiert in einem Interview mit Altenheim.net, dass es bislang keine einheitliche Anwendung der neuen Vorgaben in den Bundesländern gebe. Die Folge: Missverständnisse, Verunsicherung und eine unklare Umsetzung in der Praxis.
Wipp sieht die Hauptursachen in:
-
fehlender Informationsweitergabe an Führungskräfte,
-
zu wenig praxisnahe Kommunikation,
-
und einer mangelnden transparenz in der Einführung.
Sein Appell: Es braucht eine einheitliche, bundesweite Regelung, begleitet von verständlichen Erklärungen, Schulungen und einer klaren Zielsetzung, damit Einrichtungen PeBeM nicht nur umsetzen – sondern auch verstehen und nutzen können.
Zusammenfassung: Die wichtigsten zur PeBeM auf einen Blick
-
Die PeBeM trat am 1. Juli 2023 in Kraft und ersetzt die bisherige Fachkraftquote in stationären Pflegeeinrichtungen.
-
Sie gilt für alle vollstationären Einrichtungen der Langzeitpflege.
-
Grundlage ist die Rothgang-Studie, die einen erheblichen Personalmehrbedarf nachweist – insbesondere bei Assistenzkräften (QN 3).
-
Der Personalbedarf wird künftig individuell berechnet – anhand der Anzahl der Bewohner:innen und deren Pflegegrade (1–5).
-
Es werden drei zentrale Qualifikationsgruppen berücksichtigt:
-
Pflegefachkräfte (QN 4)
-
Assistenzkräfte mit 1–2-jähriger Ausbildung (QN 3)
-
Hilfspersonal ohne Ausbildung bzw. mit Basiskurs (QN 1 und QN 2)
-
-
Die PeBeM führt faktisch zu einer Absenkung der Fachkraftquote zugunsten eines ausgewogenen Qualifikationsmixes.
-
Ziel ist eine bedarfsgerechte Pflege, bessere Arbeitsbedingungen und eine attraktivere Berufsperspektive.
-
Die Umsetzung bedeutet einen tiefen Eingriff in etablierte Rollenbilder, Strukturen und Verantwortlichkeiten.
-
Empfehlung für Arbeitgeber: Führen Sie frühzeitig einen Soll-/Ist-Abgleich Ihres Personalbestands durch und prüfen Sie Qualifizierungs- und Finanzierungsmöglichkeiten.
Video: Die neue Personalbemessung (PeBeM) einfach erklärt
Die neue Personalbemessung war auch Thema in unserem Podcast „Mission Pflege“.
In der Folge sprechen Silvan Schroeren (Gründer von Care Rockets und Gesundheits- und Krankenpfleger a.D.) und Tobias Schmitz darüber,
-
welche Veränderungen PeBeM für Pflegekräfte und Arbeitgeber mit sich bringt,
-
worauf es in der Umsetzung wirklich ankommt
.jpg)


%20aktuell.png?width=300&height=300&name=Podcast%20Cover%20(Close%20Up)%20aktuell.png)